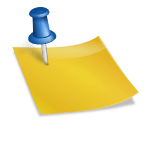Was ist eine hyperbare Sauerstofftherapie?
Die hyperbare Sauerstofftherapie dient der Steigerung der Sauerstoffaufnahme im Blut. Die Sauerstoffversorgung im Körper wird so weit gesteigert, dass dies positive Auswirkungen auf schlecht durchblutetes Gewebe hat. Unter Normalbedingungen ist das Hämoglobin, also der Blutfarbstoff in den Erythrozyten (rote Blutkörperchen) von Grund auf mit Sauerstoff gesättigt. Und zwar bis fast 99 Prozent. Das bedeutet, dass sich eine Steigerung der Sauerstoffzufuhr durch das normale Einatmen nicht erzielen lässt. Dies lässt sich jedoch mit der hyperbaren Sauerstofftherapie bezwecken. Bei dieser Therapieform wird der Außendruck mittels Dekompressionskammer auf das 2 bis 3-fache des Normalsdrucks erhöht. Physikalisch wird dadurch mehr Sauerstoff gelöst. Dies geschieht in den flüssigen Bestandteilen des Blutes. Die Menge verhält sich proportional zum Sauerstoffanteil im Atemgas und zum Umgebungsdruck. Mit der HBO lassen sich also bis zu sieben Prozent und damit mehr als das 20-fache an Sauerstoff im Blut lösen. Auf diese Weise lässt sich der Stoffwechsel beschleunigen, was einen schnelleren Heilungsprozess zur Folge hat.
Wann ist die hyperbare Sauerstofftherapie sinnvoll?
Bedauerlicherweise ist die HBO in Deutschland noch immer ein umstrittener Therapieansatz. Bislang wurden nur wenige hochwertige Studien zu diesem Thema veröffentlicht. Somit lässt sich die Wirksamkeit der HBO nur mäßig beurteilen. Dennoch wird die Therapie bei der Behandlung der unterschiedlichsten Krankheiten eingesetzt:
- Diabetisches Fußsyndrom
- Erkrankungen des Innenohrs
- Akuter Hörsturz
- Morbus Menière
- Tinnitus (Ohrgeräusche)
- Blasenentzündung nach Bestrahlung (Strahlenzystitis)
- Knall- und Lärmtrauma
- Brandwunden
- Wundheilungsstörungen
- Chronische Entzündungen
- Durchblutungsstörungen der Knochen oder der Knochenhaut
- Kohlenmonoxidvergiftung
- Spätfolgen nach Strahlentherapie
- Fistelbildung (Unnatürliche Verbindungen von Hohlorganen)
- Knochendefekte
- Tauchunfälle und Dekompressionskrankheit
Gibt es Risiken während der hyperbaren Sauerstofftherapie?
Bevor es an die Behandlung geht, klärt der Arzt den Patienten über potentielle Risiken und Nebenwirkungen auf. Zwar sind Risiken bei der HBO eher selten, jedoch können diese trotz korrekter Anwendung auftreten. So kann es beispielsweise passieren, dass das Trommelfell Schaden nimmt, wenn die HBO beim sogenannten Barotrauma angewendet wird und es beim Druckausgleich zu Problemen zwischen Mittelohr und Gehörgang kommt. Außerdem ist das Risiko der vorübergehenden Überempfindlichkeit in Bezug auf den Sauerstoff im Gehirn existent. Diese Sauerstoffüberempfindlichkeit kann sich in Gefühlsstörungen und Krämpfen äußern. Diese Symptome bleiben jedoch ohne Folgen. Und das gilt auch für eine vorübergehende Beeinträchtigung des Sehvermögens. Diese bedarf keiner weiteren Behandlung.
Was muss bei der HBO beachtet werden?
Geht es um die Kostenübernahme, so schalten sich die Krankenkassen nur bei bestimmten medizinischen Indikationen ein. So wurde es zumindest vom Bundessozialgericht beschlossen. Leidet der Patient zum Beispiel unter dem Diabetischen Fußsyndrom, müssen die gesetzlichen Krankenkassen zahlen, während es bei der Behandlung mit der HBO eines Hörsturzes oder Tinnitus zur Einzelfallentscheidung wird.
HBO bei schwerem Diabetischem Fußsyndrom
Wie bereits erwähnt, wird bei der HBO reiner Sauerstoff innerhalb einer Druckkammer eingeatmet. Diese Therapie wird häufig bei Menschen mit Diabetes eingesetzt, sodass Wunden an den Füßen schneller beziehungsweise besser heilen. Der Diabetes mellitus kann im Laufe der Jahre dafür sorgen, dass die kleinen Nerven und Blutgefäße in den Füßen geschädigt werden. Die Folge: Druck- und Schmerzempfindlichkeit, sowie das Tastgefühl lassen dabei nach. Der Patient mit Diabetes merkt in solchen Fällen nicht mehr, dass sich am Fuß Wunden bilden, welche beispielsweise durch schlecht sitzende Schuhe hervorgerufen werden. Auch beim Barfußlaufen und beim Schneiden der Fußnägel nimmt der Patient keine Berührung mehr wahr. Außerdem heilen die entstandenen Wunden schlechter, als es bei gesunden Menschen der Fall ist.
Die korrekte Behandlung schlecht heilender Füße
Werden diese Wunden nicht rechtzeitig behandelt, kann es passieren dass sich die Knochen und das drum herumliegende Gewebe entzünden. Nicht zuletzt kann das Gewebe auch absterben. Kommt es zu solchen Veränderungen, werden diese als Diabetisches Fußsyndrom“ oder auch als „Diabetischer Fuß“ bezeichnet. Patienten die unter dem dieser Krankheit leiden, haben in der Regel über mehrere Monate hinweg Probleme damit. Diese Menschen dürfen ihren Fuß nur sehr wenig belasten und sind dadurch im Alltag sehr eingeschränkt. Jede Wunde muss sorgfältig behandelt werden. Zu dieser Behandlung zählt das gründliche Reinigen der Wunde, das Verbinden oder auch die Darreichung von bestimmten Medikamenten. Die Behandlung richtet sich nach der Größe, der Tiefe und der Lokalisation der Wunde. Wird die gründliche Behandlung vernachlässigt, muss der Fuß im schlimmsten Fall amputiert werden.
Diskussionspotential für die Krankenkassen
Die Krankenkassen zahlen die HBO nur unter bestimmten Voraussetzungen. Meistens werden die Kosten nur dann übernommen, wenn andere Therapien erfolglos geblieben sind. Das trifft natürlich auch zu, wenn die Amputation des Fußes droht. Abgesehen davon, wird die HBO nur in wenigen Behandlungszentren und Kliniken angeboten.
Wie funktioniert die Druckkammer?
Die Kompressionskammer stellt einen druckfesten und luftdichten Behälter dar, welcher zur kontrollierten Absenkung und Steigerung des Umgebungsdrucks eingesetzt wird. In der Regel besteht die Kammer aus Stahl oder Verbundstoffen. Hin und wieder werden auch reißfeste Textilien für begrenzte Druckanwendungen genutzt. Die therapeutische Behandlung betrifft auch die sogenannte hyperbare Sauerstofftherapie (HBO).
Die Druckkammer bei der Taucherkrankheit
Die Taucherkrankheit ist auch unter einer weiteren Bezeichnung bekannt: Die Dekompressionskrankheit. Abgekürzt wird diese mit „DCS“ und bedeutet im Englischen ausgeschrieben: Decompression Sickness. Weitere Bezeichnungen sind die Druckfallkrankheit oder die Caissonkrankheit. Diese Krankheit resultiert aus einem Tauchunfall, wenn der Betroffene zu schnell aufgetaucht ist.
Stickstoff breitet sich im Körper aus
Je tiefer sich der Taucher unter Wasser begibt, umso höher wird der Wasserdruck, welcher auf ihm lastet. Dieser Druck wirkt sich auf die Lunge beziehungsweise auf der darin enthaltenen Atemluft aus. Die Lunge beinhaltet Stickstoff, welcher dann austritt und sich sowohl im Blut, als auch in anderen Organen verteilt. Der Sauerstoff wird hingegen vom Körper verbraucht. Je tiefer sich der Taucher in die Gewässer begibt, desto mehr Stickstoff breitet sich im Körper aus. Der menschliche Körper ist allerdings nur darauf programmiert, eine bestimmte Menge Stickstoff aufzunehmen. Das hängt sowohl vom Druck, als auch von der Temperatur ab.
Was passiert bei der Taucherkrankheit?
Die Begrifflichkeit „Dekompression“ wird bei Tauchgängen verwendet und bezeichnet den Druck, welcher kontrolliert reduziert werden muss, nachdem der Körper damit belastet wurde. Bei dieser Krankheit findet ein zu rascher Druckausgleich statt, weshalb sich im Blut des Betroffenen Gasblasen bilden. Die Gasblasen können nicht nur Hautrötungen und Juckreiz auslösen, sie können im Ernstfall sogar zu lebensgefährlichen Gefäßverschlüssen führen.
Die Historie der Dekompressionserkrankung
Die Symptome der Taucherkrankheit wurden zum ersten Mal in Frankreich beobachtet. In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in Bezug auf die Caissonsarbeiter auffällige Reaktionen nach deren Erdarbeiten auf dem Grund von verschiedenen Gewässern dokumentiert. „Caisson“ ist französisch und bedeutet: Kasten. Bei diesen Arbeiten wurden die Taucher mittels spezieller Senkkästen, also den Caissons auf den Meeresgrund herabgelassen. Als die Arbeiter dann wieder nach oben geholt wurden, klagten einige von ihnen über bestimmte Beschwerden. Dies kann auch Tauchern passieren, welche die bestimmten Auftauchzeiten nicht einhalten und dementsprechend zu schnell an die Wasseroberfläche gelangen. Diese Historie hat dafür gesorgt, dass die Beschwerden als Caissonkrankheit bezeichnet werden.
Weitere Auswirkungen eines Tauchunfalls
Die Behandlung und die Symptome der Taucherkrankheit ähneln einem anderen sehr ähnlichen Tauchunfall: Der arteriellen Gasembolie, welche mit AGE abgekürzt wird. Dabei handelt es sich um einen Lungenüberdruckunfall, bei welchem ebenfalls Luftblasen entstehen. Diese verstopfen unter anderem die Lungengefäße. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die arterielle Gasembolie und die Taucherkrankheit unter dem Begriff Dekompressionserkrankung zusammengefasst werden. Die englische Abkürzung dafür lautet: DKI und steht für Decompression Illness.
Die Therapie muss rasch erfolgen
Besteht der Verdacht auf die Taucherkrankheit, muss so schnell wie möglich eine Therapie eingeleitet werden. Diese findet unmittelbar in Form von erster Hilfe nach dem Tauchgang statt. Zusätzlich sollte der Notarzt gerufen werden.
Erste Hilfe bei Tauchunfällen
Wenn ein Taucher zu schnell an die Wasseroberfläche gelangt ist und die Symptome der Taucherkrankheit aufweist, muss sofort erste Hilfe geleistet werden. Der Taucher sollte so schnell wie möglich von seinem Taucheranzug und den Gasflaschen befreit werden. Sofern der Betroffene normal atmet aber bewusstlos ist, sollte er in die stabile Seitenlage gebracht werden. Es ist darauf zu achten, dass die Atemwege freigehalten werden. Ist der Taucher noch bei Bewusstsein, muss er auf den Rücken gelegt werden. Es ist in jedem Fall der Notruf 112 zu wählen. Die anschließende Behandlung definiert sich über die sofortige Dekompression, sowie die Sauerstoffbehandlung. Diese Überdruckbehandlung findet in einer Überdruckkammer statt, welche von einem Taucharzt beaufsichtigt wird.
Vorsicht bei Tauchausflügen im Urlaub
Die Dekompression sieht es vor, dass der betroffene Taucher auf den Umgebungsdruck gebracht wird. Auf diese Weise lösen sich die Stickstoffbläschen im Blut des Betroffenen auf. Viele in Europa ansässige Tauchzentren sind mit derartigen Druckkammern ausgestattet. Wer im Urlaub auf Tauchkurs geht, sollte bedenken, dass eine Dekompression unter Umständen nicht so schnell möglich sein kann, da sich keine Überdruckkammer in der Nähe des Meeres befindet oder auf dem Boot befindet.
So lässt sich die Krankheit vorbeugen
Die Taucherkrankheit lässt sich ganz einfach vermeiden, indem der Taucher die vorgeschriebenen Auftauchzeiten einhält. Diese werden auch als Dekompressionszeiten bezeichnet. Mit der Dekompressionszeit wird der Zeitrahmen bezeichnet, welcher vom Taucher mindestens benötigt wird, um ohne Probleme und daraus resultierenden Schäden aufzutauchen. Es ist grundsätzlich ratsam niemals alleine auf Tauchkurs zu gehen. Denn im Notfall braucht der Taucher einer Partner, welcher schnell eingreifen kann. Ebenso wichtig ist es, dass der Taucher gut ausgeruht ist, bevor er sich unter die Wasseroberfläche begibt. Eine angemessene Ernährung, viel Flüssigkeit und ausreichender Schlaf können dabei sehr förderlich sein.
Außerdem wird das Risiko einer Tauchererkrankung durch folgende Faktoren erhöht:
- Mangelnde Fitness und Anstrengung unter Wasser
- Übergewicht
- Eine niedrige Wassertemperatur
- Alkoholkonsum und Medikamenteneinnahme
- Zu viele Tauchgänge in einem kurzen Zeitraum
- Flüssigkeitsmangel (Dehydratation)
- Ein Flug direkt nach dem Tauchgang
Letzteres sorgt dafür, dass der Druckabfall im Flugzeug zu vermehrten Gasbläschen im Gewebe und im Blut führen kann. Deshalb ist es sehr wichtig, dass zwischen dem letzten Tauchgang und dem Flug mindestens 24 Stunden liegen.